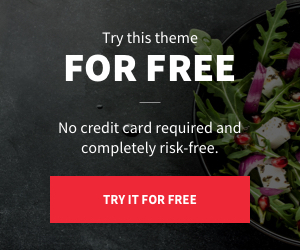Am 7. Dezember findet im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin die Buchpräsentation der Schriftstellerin Olga Kolpakowa „Der Wermutstannenbaum“ über die Deportation der Russlanddeutschen in der Sowjetunion statt. Dies hat die MDZ als Anlass genutzt, um mit der Direktorin Gundula Bavendamm über die Arbeit ihres Teams zu sprechen.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung: persönliche Geschichten der Vertriebenen (Foto: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung / Markus Gröteke)
Das Zentrum befasst sich vor allem mit der Vertreibung der Deutschen aus den osteuropäischen Ländern nach Deutschland. Wie passt die Geschichte aus dem Buch von Olga Kolpakowa zum Profil des Zentrums?
Das Dokumentationszentrum befasst sich ja nicht nur mit der Vertreibung der deutschen Mehrheitsbevölkerung aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches, sondern auch mit dem ebenfalls schweren Schicksal der deutschen Minderheiten, die aus ihren jahrhundertealten Siedlungsgebieten vertrieben oder deportiert wurden. Viele dieser Menschen kamen Jahrzehnte später als sogenannte Spätaussiedler in die Bundesrepublik Deutschland. Die stalinistischen Deportationen von Minderheiten innerhalb der Sowjetunion kommen in der Ständigen Ausstellung zwar vor, werden aber nicht in größerem Umfang dargestellt. Insofern begrüße ich diese Veranstaltung ganz besonders.
Was sind die Themen, die das Zentrum anspricht?
Die deutschen Heimatvertriebenen sind ein Schwerpunkt der Programmarbeit, aber eingebettet in einen europäischen Kontext und mit vielfältigen Verbindungslinien in die Gegenwart. Vor wenigen Tagen wurde bei uns zum Beispiel ein neues Buch über den Vertrag von Lausanne 1923 vorgestellt. In dem Abkommen wurde zwischen Griechenland und der Türkei der erste staatlich organisierte Bevölkerungsaustausch von 1,7 Millionen Betroffenen vereinbart. Was die Gegenwart angeht, haben wir uns in den letzten Monaten wiederholt mit der Ukraine beschäftigt. Im kommenden Jahr eröffnen wir eine Sonderausstellung über Flüchtlinge in heutigen Krisengebieten, etwa in Afrika oder im Nahen Osten. Es geht um die vielen Hindernisse, die sie meist überwinden müssen, um eine Hochschule besuchen zu können.
Die Deportation der Deutschen aus Polen und aus der Tschechoslowakei gen Westen und aus dem Wolgagebiet gen Osten ist schon Geschichte, die mehr als 75 Jahre alt ist. Ist diese Wunde noch nicht geheilt?
Es gibt immer noch Menschen der sogenannten Erlebnisgeneration. Sie sind oft bis an ihr Lebensende von den Gewalterfahrungen belastet, auch wenn sie Jahrzehnte zurückliegen. Aber es gibt die zweite und inzwischen die dritte Generation. Wir merken besonders am Austausch mit dieser Besuchergruppe, wie lange es dauert, bis die nicht sichtbaren Narben von Vertreibung oder Deportation heilen. Dabei geht es oft um diffusere Dinge: das Schweigen in den Familien; die Reue, dass man mit den Älteren nicht rechtzeitig gesprochen hat; ein untergründiges Gefühl von Unbehaustheit.
Sind Auswirkungen jener Vertreibung noch heute spürbar?
Ja. Viele, die zu uns kommen, haben eine familiengeschichtliche Verbindung zur Vertreibung und Flucht. Auch im privaten Umfeld passiert es mir häufig, dass man mit unbekannten Menschen nach ein paar Sätzen beim Thema Vertreibung oder Flucht ist und das Gespräch dann eine erstaunlich persönliche Wendung nehmen kann.
Wer interessiert sich vor allem für das Thema? Sind es meistens Vertreter der älteren Generation oder gibt es Interesse seitens der jüngeren Menschen?
Gerade in den ersten Monaten der Eröffnung sind viele Besucher und Besucherinnen aus der sogenannten Erlebnisgeneration gekommen. Sie hatten ja lange auf dieses Haus warten müssen. Die meisten Exponate in unserer Sammlung haben wir in den letzten zwanzig Jahren von dieser Generation bekommen. Ein markantes Phänomen ist aber auch die dritte, also die Enkelgeneration. Nicht wenige sind traurig darüber, dass sie mit ihren Verwandten nicht gesprochen haben – weil geschwiegen wurde oder weil man selbst mit dem Thema nichts zu tun haben wollte. Bei uns kann man das in gewisser Weise nachholen: In unserem schönen Lesesaal stehen eine große Fachbibliothek und Medienstationen mit Zeitzeugeninterviews zur Verfügung und wir beantworten Fragen zur Familienforschung. Durch Gegenwartsthemen holen wir aber auch andere Zielgruppen ins Haus. Kürzlich haben wir etwa erfolgreich mit dem Berliner Human Rights Festival kooperiert. Bei uns fand die Gesprächsreihe „Talking Humanity“ statt, wir hatten jedes Mal einen vollen Saal, darunter überwiegend junge Leute.
Wie eng arbeitet das Zentrum mit Archiven in Osteuropa zusammen? Gibt es heute noch Verbindung mit Archiven in Russland?
In den Jahren zur Vorbereitung der Ständigen Ausstellung haben wir natürlich mit Archiven in Osteuropa zusammengearbeitet und Leihgaben erhalten. Auch unsere Rolle als Lotse für Familienforschende jenseits von Oder und Neiße hat viel mit guten Kenntnissen der osteuropäischen Archivlandschaft zu tun. Als Bundesstiftung haben wir seit Februar 2022 offizielle Kontakte zu russischen oder weißrussischen Institutionen eingestellt. Aber über deutsche Organisationen gibt es weiterhin gute Möglichkeiten, mit Wissenschaftlern oder Vertreterinnen der Zivilgesellschaft auch aus Russland in Kontakt zu sein – viele leben teilweise schon seit Jahren in Berlin.
In einem Ihrer Interviews sagten Sie, das Dokumentationszentrum sei eine Schule der Ambivalenz. Was meinten Sie damit?
Hier im Dokumentationszentrum geht es auch um die Anerkennung des Leids und der Opfer unter den Heimatvertriebenen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn wir uns zugestehen, darüber zu sprechen, kommen wir dann in die Gefahr, dass wir vergessen oder nicht mehr sehen, dass dieses Land zuvor schlimmstes Unheil über andere gebracht hat? Wir rühren hier an die Weichstelle unseres historischen Selbstverständnisses. Wir rühren am Opfer-Täter-Schema. Wer zu uns kommt, muss sich mit den Untiefen, Widersprüchen und Spannungen der deutschen Geschichte befassen, seine eigene Haltung auf den Prüfstand stellen. In diesem Sinne sehe ich die Einrichtung als Schule der Ambivalenz.
Wie reagieren die Besucher des Zentrums auf das, was sie da mitbekommen?
Ich freue mich sagen zu können, dass das Gros der Besucher das Dokumentationszentrum positiv bewertet und unser Publikum wächst. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, das Thema Flucht und Vertreibung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Das tun wir auf allen Ebenen unserer Arbeit. Stets geht es darum, die deutschen Erfahrungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in einen europäischen Zusammenhang zu stellen und das Historische mit der Gegenwart zu verbinden. Unsere Zeit gibt uns dazu leider viele Anlässe – denken wir etwa an die Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine.
„Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.“ Und wie ist es, das Dokumentationszentrum zu führen und zum Erhalt der Erinnerungskultur beizutragen, wenn alle Bemühungen vergebens sind?
Als Historikerin bin ich eher skeptisch, ob und wie sehr aus der Geschichte gelernt wird – auch wenn dieser Topos in kaum einer „Sonntagsrede“ von Politikern oder Politikerinnen fehlt. Leider zeigt die gegenwärtige Weltlage, dass weder Nationalismus, noch Krieg, noch Vertreibung und Flucht der Vergangenheit angehören. Gruppenhass ist offenbar etwas, zu dem der Mensch fähig ist. Trotzdem bin ich sehr froh, zur Erinnerungskultur beitragen zu können. Dieses Land kann sich glücklicherweise eine solche Institution leisten, Erinnerungskultur ist Ausdruck unserer Zivilität. Wir können im Dokumentationszentrum neue Themen setzen, historische Sachverhalte erklären, das Urteilsvermögen und die Empathiefähigkeit unserer Besucher stärken und das ist viel. Es kommt auf jeden Einzelnen an!
Quelle : Moskauer Deutsche Zeitung